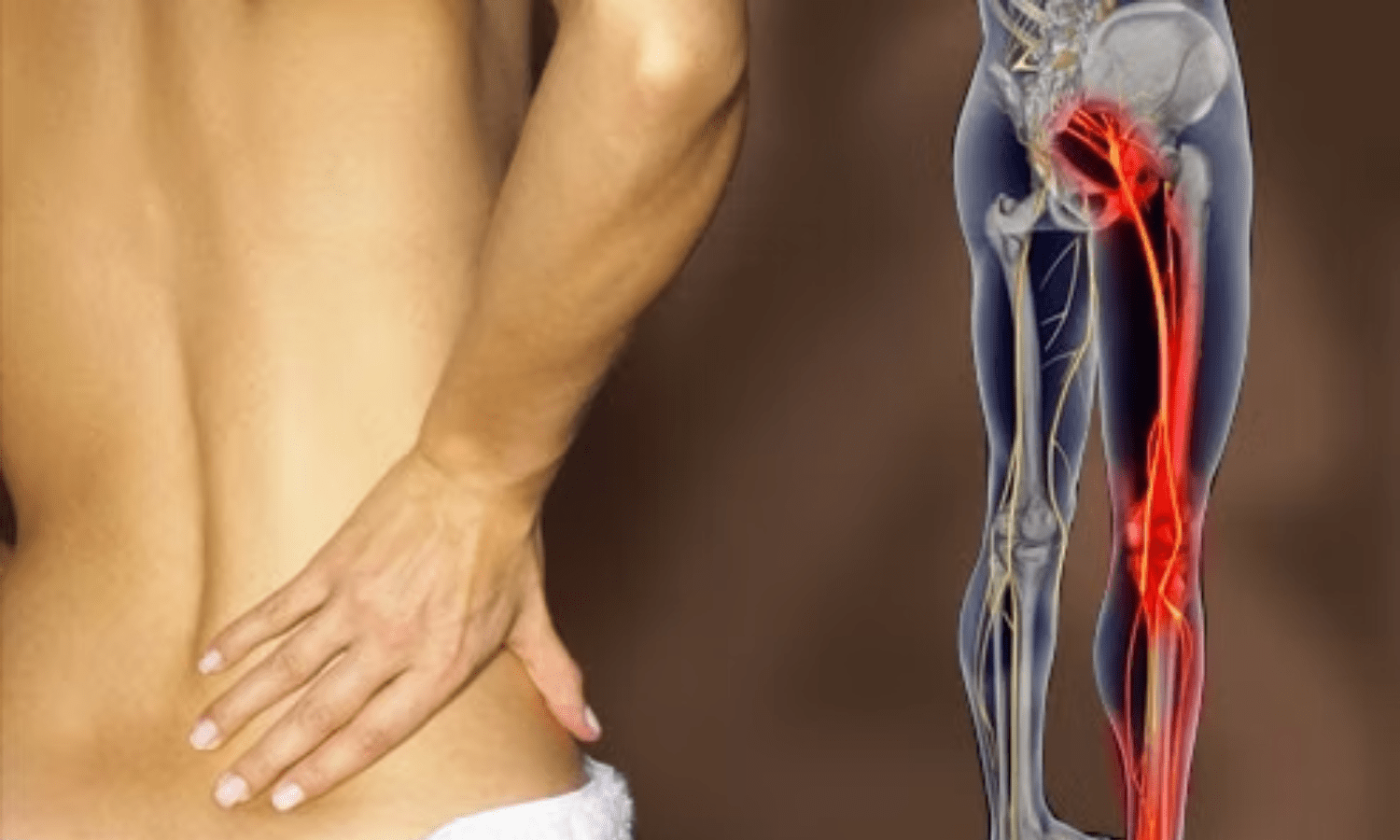Hunderte Delfine starben in Amazonasgewässern bei Rekordhitze von 41 Grad: „Es war so heiß, dass sie keinen Schutz fanden“

Weltweit erwärmen sich die aquatischen Ökosysteme, und auch der Amazonas ist von diesem Phänomen betroffen . In den letzten Jahren wurden in den Flüssen und Seen des größten Regenwaldes der Erde beispiellose Hitzewerte gemessen – ein Symptom der globalen Erwärmung , die die Tropen verändert. Laut einer am Donnerstag in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichten Studie ließen eine Dürre und eine extreme Hitzewelle die Wassertemperaturen im Jahr 2023 auf nie zuvor gemessene Werte von bis zu 41 Grad Celsius ansteigen. Diese Erwärmung hat insbesondere Auswirkungen auf Meereslebewesen und das Überleben der Flussgemeinden, deren Lebensgrundlage vom Wasser abhängt.
Die Studie, geleitet vom brasilianischen Forscher Ayan Fleischmann vom Mamirauá-Institut für nachhaltige Entwicklung , analysierte zehn Seen im zentralen Amazonasgebiet. In fünf von ihnen überstieg die Wassertemperatur 37 Grad Celsius. Im Tefé-See wurden sogar 41 Grad Celsius in der gesamten, nur zwei Meter tiefen Wassersäule gemessen. Der Wissenschaftler beschrieb das Phänomen als „perfekten Sturm“: extreme Sonneneinstrahlung, geringe Tiefe, schwacher Wind und trübes Wasser verhinderten die Ausbreitung des Sonnenlichts.
Eine ökologische und humanitäre KriseDie Dürre ließ nicht nur den Wasserstand der Flüsse sinken, sondern heizte sie auch extrem auf. „Man konnte keinen Finger ins Wasser halten. Es war so heiß, dass die Tiere keinen Schutz fanden. Fische und Delfine starben, weil es am Grund des Sees kein kühles Wasser mehr gab“, klagt er. „Es ist eine ökologische und humanitäre Krise zugleich.“
Alle Komponenten des Ökosystems – Fische, Delfine, Phytoplankton – waren betroffen. Das Team dokumentierte über 200 tote Delfine im Tefé-See. „Diese Temperaturen überschreiten die thermische Toleranz der meisten Amazonasarten. Doch aus irgendeinem Grund flohen die Delfine nicht; sie blieben im See, bis sie starben.“ Die Erwärmung störte auch die Nahrungskette. „Der See färbte sich rot, weil Algen ihre Pigmentierung veränderten“, bemerkt Fleischmann.
Die Durchquerung der von Dürre geplagten Region erwies sich laut Fleischmann als schwierig, nicht nur wegen der eingeschränkten Mobilität, sondern auch wegen der emotionalen Belastung für das Team. „Was normalerweise drei Stunden mit dem Boot dauerte, dauerte plötzlich acht oder zehn. Und neben der Hitze waren viele Kollegen tief betroffen von dem, was sie sahen: Hunderte von Delfinkadavern, ganze isolierte Gemeinschaften, Menschen ohne Wasser und Nahrung.“
Die Auswirkungen, erklärt Pepe Álvarez, ein spanischer Biologe, der in Peru lebt, waren verheerend für die Wasserlebewesen. Nicht nur wegen der Todesfälle, sondern auch wegen der Störung ihrer Fortpflanzungszyklen. Fische, die normalerweise in großen Schwärmen laichen (wie Carachamas und Boquichicos), sind auf die jährlichen Überschwemmungen zur Fortpflanzung angewiesen. Während der Dürrejahre sanken die Flusspegel jedoch so stark, dass Tausende von Fischen in isolierten Seen gefangen waren. „In Peru gab es zwar nicht so viele sichtbare Todesfälle wie in Brasilien, aber es herrschte ein akuter Fischmangel.“

Dürreperioden legten das tägliche Leben im Amazonasgebiet lahm. Tausende Familien an den Flussufern waren ohne Transportmittel, Wasser und Fisch – ihrer Hauptnahrungsquelle. Ein UNICEF-Bericht vom November 2024 schätzte, dass mehr als 420.000 Kinder von Wassermangel und dem damit verbundenen Schulbesuchsausfall betroffen waren . In Brasilien waren aufgrund des niedrigen Wasserstands der Flüsse mehr als 1.700 Schulen und 760 Gesundheitszentren nicht mehr erreichbar.
„Wenn die Fische sterben, ist die Ernährungssicherheit gefährdet“, fasst Fleischmann zusammen. Transport, Bildung und Handel sind in den Flussgemeinden auf Wasser angewiesen. „Wenn die Schifffahrt unmöglich ist, gerät die gesamte Sozialwirtschaft der Region aus den Fugen.“
Der Artikel von Fleischmann und seinem Team konzentriert sich auf das Jahr 2023, das Jahr, in dem sie mit der Untersuchung des Phänomens begannen. Die Dürre dauerte jedoch bis 2024 an. „Wir können sagen, dass es die schlimmste jemals verzeichnete Dürre war“, so der Hydrologe. „Wir wissen nicht, was in den vergangenen Jahrhunderten geschah, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es sich, basierend auf den uns vorliegenden Daten, um die schlimmste Dürre seit mindestens 120 Jahren handelte.“
Laut Forschern erlebt die Region einen anhaltenden Erwärmungsprozess – 0,6 °C pro Jahrzehnt seit 1990 –, der durch Abholzung, extreme Dürren und den globalen Klimawandel verursacht wird. „Die Seen erwärmen sich seit Jahrzehnten kontinuierlich, und wenn dieser Trend mit extremer Dürre zusammentrifft, schafft er ideale Bedingungen dafür, dass sich das Wasser noch weiter erwärmt und eine sogenannte Spätsommerhitze auslöst“, erklärt Fleischmann.

Für Dr. Adalberto Val, der seit über vierzig Jahren in seinem Labor in Manaus (Brasilien) die Physiologie der Fische des Amazonas erforscht, wirkt der Klimawandel hier als multidimensionaler Faktor: „Er beeinflusst den Wald, die Luft, die Flüsse, die Seen und alles, was darin lebt.“
Laut einem Forscher des brasilianischen Instituts für Amazonasforschung (INPA) reagieren die meisten Wasserorganismen des Amazonasgebiets extrem empfindlich auf Hitze. „Wenn die Temperatur steigt, wird das ohnehin schon sauerstoffarme Wasser noch sauerstoffärmer. In Gebieten wie dem Rio-Negro-Becken, wo das Wasser bereits von Natur aus sauer ist, wird es dadurch noch saurer. Das ist eine tödliche Kombination.“ Die Folgen, so der Forscher, zeigten sich während der Dürreperioden von 2023 und 2024: ein massives Tiersterben. „Fische können ihre Körpertemperatur nicht mehr regulieren. Sobald das Wasser 41 Grad Celsius erreicht, stellen sie ihre Funktionen ein: Ihre Enzyme versagen, ihr Stoffwechsel bricht zusammen, und sie sterben.“
Der Wissenschaftler beschreibt ein Szenario des ökologischen Ungleichgewichts: „Der Tefé-See hat 75 % seiner Fläche verloren. Er schrumpfte von 400 auf 100 Quadratkilometer. Seine Tiefe verringerte sich von 13 Metern auf einen halben Meter.“ Und die Delfine, die ihre Körpertemperatur selbst regulieren können, konnten nicht überleben . „Sie müssen enorm viel Energie aufwenden, um zu überleben, und in einer ausgelaugten Umgebung, ohne Nahrung und Unterschlupf, können sie diese Anstrengung nicht aufbringen.“
Ein sich wiederholendes MusterDie Dürreperioden von 2023 und 2024 waren keine Einzelfälle. Zwei Jahre zuvor erlebte Brasilien die schlimmste Dürre seit fast einem Jahrhundert mit rekordniedrigen Niederschlägen und gravierenden Auswirkungen auf Landwirtschaft und Energiewirtschaft.
Im Jahr 2023 sanken die Flusspegel um bis zu 20 Zentimeter pro Tag. Doch 2024 brachte eine bemerkenswerte Verbesserung: Die Abholzung im Amazonasgebiet ging auf 5.796 km² zurück , 11 % weniger als im Vorjahr – der beste Wert seit über einem Jahrzehnt. Die Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva, unter der Leitung von Umweltministerin Marina Silva, verstärkte die Kontrollen, reaktivierte den Amazonasfonds und koordinierte 19 Ministerien in einer Kampagne zur Eindämmung der Abholzung. Diese Bemühungen fallen mit dem Klimagipfel (COP30) zusammen, der vom 10. bis 21. November dieses Jahres in Belém, im Herzen des Amazonasgebiets, stattfindet.
Für Núria Bonada, Professorin für Ökologie an der Universität Barcelona, verändert der Klimawandel die hydrologischen Muster unseres Planeten grundlegend. „Rund 60 % des weltweiten Flussnetzes leiden jedes Jahr unter Dürren, und alles deutet darauf hin, dass diese häufiger und länger andauern werden“, warnt sie. In diesem Zusammenhang erweist sich das Amazonasbecken – unzureichend überwacht und mit einer hohen Biodiversität – als eines der am stärksten gefährdeten Ökosysteme.
Dennoch widersetzt sich Ayan Fleischmann dem Fatalismus: „Zweihundert Delfine sind im Tefé-See gestorben, aber es gibt Tausende von Seen, in denen dies nicht passiert ist. Es ist noch Zeit, etwas zu ändern und zu verhindern, dass dies wieder geschieht.“
EL PAÍS